Den Hieb pariert. Oder: Wie man gute Kämpfe schreibt
- Kornelia Schmid

- 2. März 2025
- 4 Min. Lesezeit
Das Problem an Kampfszenen ist Folgendes: Meistens ist ihr Ausgang von vornherein klar und die Spannung schnell dahin. Leser:innen müssen sich dann durch irrelevante Beschreibungen quälen – oft werden die auch einfach überblättert. Es gibt aber ein paar Tricks, um trotzdem Spannung aufkommen zu lassen. Welche, lest ihr in meinem Artikel.

Patei A haut hierhin. Partei B haut dahin. A pariert das und haut zurück. B weicht aus und haut zurück. A haut und landet einen Treffer. B beißt die Zähne zusammen und haut zurück. A pariert und haut zurück.
Das könnte noch ewig so weitergehen. Und in manchen Büchern tut es das auch. Ist das aber spannend? Sorgt es für Überraschungen? Bringt es die Handlung voran? In meinen Augen nicht. Wie kann man es anders machen?
Die Umgebung miteinbinden
In der Realität sind Kämpfe in der Regel ziemlich schnell vorbei. Endlose Schauduelle gibt es in Büchern und Filmen, sie sind meist jedoch wenig plausibel. Soll eine Kampfszene länger, aber dennoch überzeugend werden, kann es helfen, neue Vorraussetzungen zu schaffen.
Stehen sich die Kontrahenten nicht auf einem Kampfplatz, sondern auf einer gefrorenen Ebene gegenüber, sind plötzlich neue Fähigkeiten gefragt (Pen-&-Paper-Rollenspieler:innen können ein Lied davon singen – ich sage nur "Würfle auf Geschlicklichkeit"). Wenn der Zufall mit reinspielt, wenn jeder ausrutschen könnte, ist der Ausgang eines Kampfes plötzlich ungewiss – auch dann, wenn eine der beiden Parteien eigentlich klar überlegen wäre.
Trübt der Regen die Sicht, verschluckt Nebel den Gegner, brennt Öl am Boden und muss auf einer schaukelnden Brücke balanciert werden – all das bietet auch die Möglichkeit, die Szene mit mehr Bildern, mehr Atmosphäre anzureichern. Wie ihr in Texten Atmosphäre beschreibt, könnt ihr übrigens auch hier nachlesen: https://www.kornelia-schmid.de/post/wie-erzeugt-man-in-romanen-atmosphaere.
Kampfszenen können also durch eine interessante Umgebung profitieren. Und auch, wenn sich hartnäckig das Gerücht hält, über das Wetter zu schreiben, wäre langweilig: Hier ist es absolut sinnvoll!
Der unerwartete Ausgang
Die Held:in gewinnt ja ohnehin, nicht wahr? Schließlich ist sie die Held:in. Ohne sie würde die Handlung nicht weitergehen. Also kann sie gar nicht verlieren.
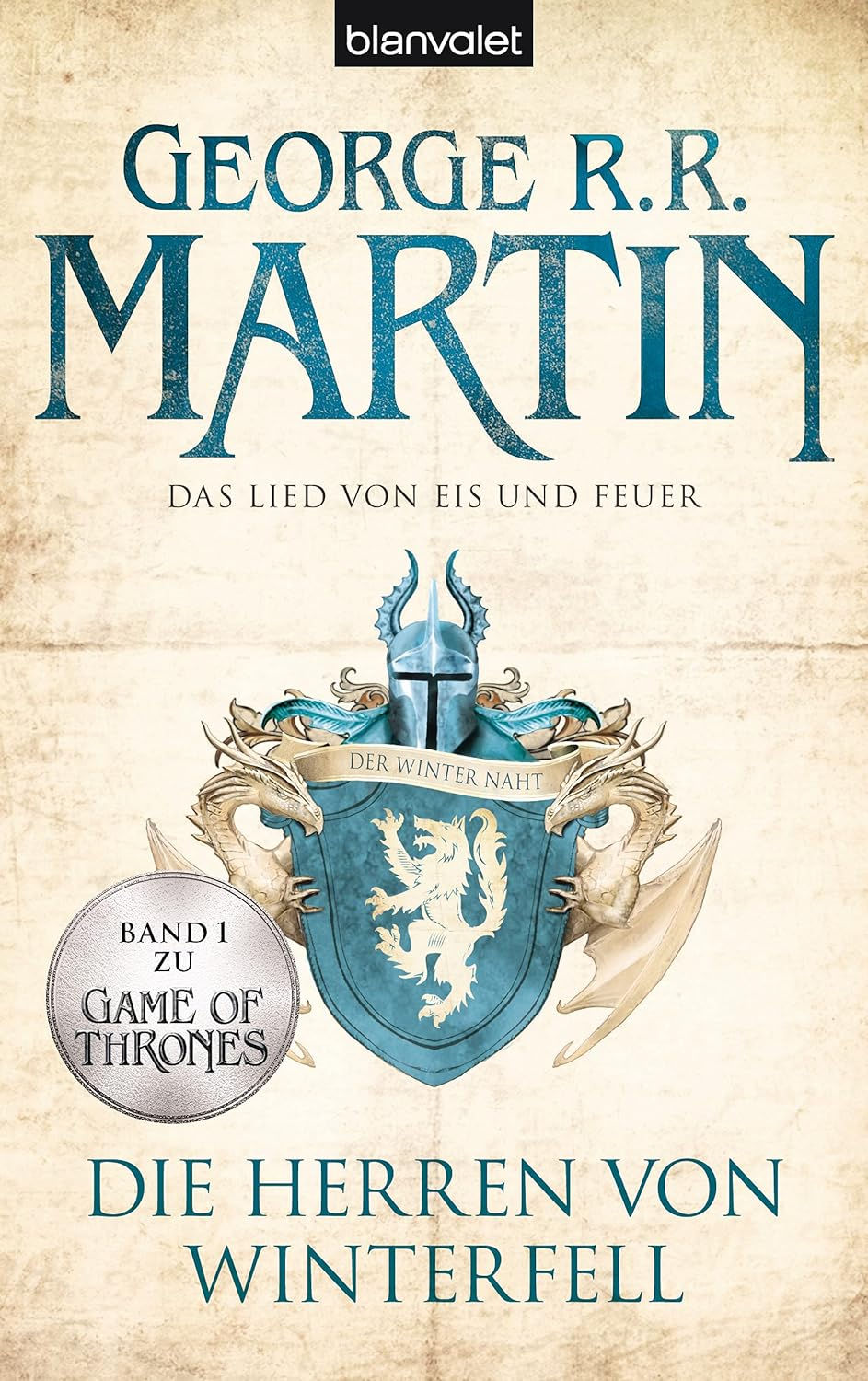
Nun, was wäre wenn doch? "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin sowie die dazugehörige Fernsehseie "Game of Thrones" hat eindrucksvoll mit dieser Technik gearbeitet. Während das Publikum davon ausging, dass die Protagonist:innen unantastbar wären, starben sie im Buch und am Bildschirm. Das Erschrecken war groß. Und wenn plötzlich jeder Ausgang möglich ist, dann sind Kampfszenen auch wieder spannend.
Nun mag es natürlich nicht in jede Konzeption passen, die Protagonist:in sterben zu lassen. Aber kann sie nicht vielleicht trotzdem verlieren? Oder kann sie zwar gewinnen, dafür aber einen hohen Preis zahlen, der ihr Leben für immer verändert? Was wäre, wenn sie zwar gewinnt, dabei aber eine schwerwiegende Verletzung davonträgt, die sie für immer an den Rollstuhl fesselt und damit ihre Karriere an der Soldat:innenakademie ruiniert?
Leser:innen rechnen nicht mit dem schlechtmöglisten Ausgang. Sie wollen das Beste für die liebgewonnen Figuren. Deswegen ist es so aufwühlend, wenn stattdessen etwas Schlechtes eintritt. Es entsteht das Bedürfnis, eine Lösung aus der misslichen Lage zu finden. Und das wiederum sorgt dafür, dass die Leser:innen am Ball bleiben. Es sorgt für Spannung.
Und natürlich gilt das nicht nur für Kampfszenen: Ist die Fallhöhe hoch (das bedeutet, dass für Protagonist:innen besonders viel auf dem Spiel steht, dass sie alles verlieren können), macht das einen Text intensiver und damit spannender. Wie ihr generell in Texten Spannung erzeugen könnt, lest ihr übrigens auch hier: https://www.kornelia-schmid.de/post/spannung-in-romanen-erzeugen.
Der neu entstehende Konflikt
Der Ausgang des Kampfes ist zwar klar, aber dabei passiert etwas, mit dem niemand rechnen konnte. Das Rollstuhlbeispiel einen Absatz höher kann man sicher auch in diese Kategorie einordnen. Doch die unerwartete Wendung muss nicht unbedingt immer Gesundheit und Lebensentwurf der Protagonist:in beeinträchtigen. Sie könnte beispielsweise auch ihre Beziehungen auf die Probe stellen. Was wäre beispielsweise, wenn sie die Gegenpartei zwar besiegt, diese dabei aber eine Information preisgibt, die nur eine nahestehende Person wissen kann? Plötzlich ist der Sieg bedeutungslos – denn die Protagonist:in muss sich stattdessen mit etwas viel Gewichtigerem auseinandersetzen, nämlich einem tiefgehenden Verrat. Die Kampfszene ist dann nur ein Mittel, um einen anderen Konflikt voranzutreiben. Und das kann wunderbar funktionieren.
Strategie anstelle von Kampf
Geht es nicht um einzelne Duelle, sondern um eine ganze Schlacht, kann man auch eine andere Herangehensweise wählen, nämlich die, sich mehr auf die Gesamtstrategie zu konzentrieren.
Das habe ich beispielsweise in "Das Licht im Sand" getan. Natürlich erfährt man, welche Angriffe die einzelnen Figuren auf dem Schlachtfeld erdulden müssen, doch das ist eher knapp gehalten. Vielmehr geht es darum, wie man eine uneinnehmbare Wüstenstadt erobert. Denn das Gelände bietet keine Deckung, für eine Belagerung fehlen die Soldaten, die Versorgungslinien der angreifenden Partei sind nicht gesichert – schlechte Ausgangsbedingungen also. Der General hat aber ein paar Tricks auf Lager. Anstelle von Kampfbeschreibungen geht es in den Schlachtkapiteln also vielmehr darum, mit welchen Mitteln hier gearbeitet wird und ob diese funktionieren. Dazu ist natürlich ein wenig Wissen notwendig, wie Militärstrategien funktionieren. Zur Recherche empfehle ich als erstes Sunzis "Die Kunst des Krieges". Ein erhellender Text, den es als Reclambüchlein zu kaufen gibt.
Kämpfe sollten nicht für sich stehen
Bei allen diesen Methoden geht es darum, Kämpfe nicht isoliert zu betrachten. Sie sollten nicht für sich stehen, sondern Informationen liefern, die über den eigentlichen Kampf hinausgehen und/oder Entwicklungen anstoßen, die das Kampfgeschehen überdecken. Und dann werden sie auch nicht mehr überblättert.

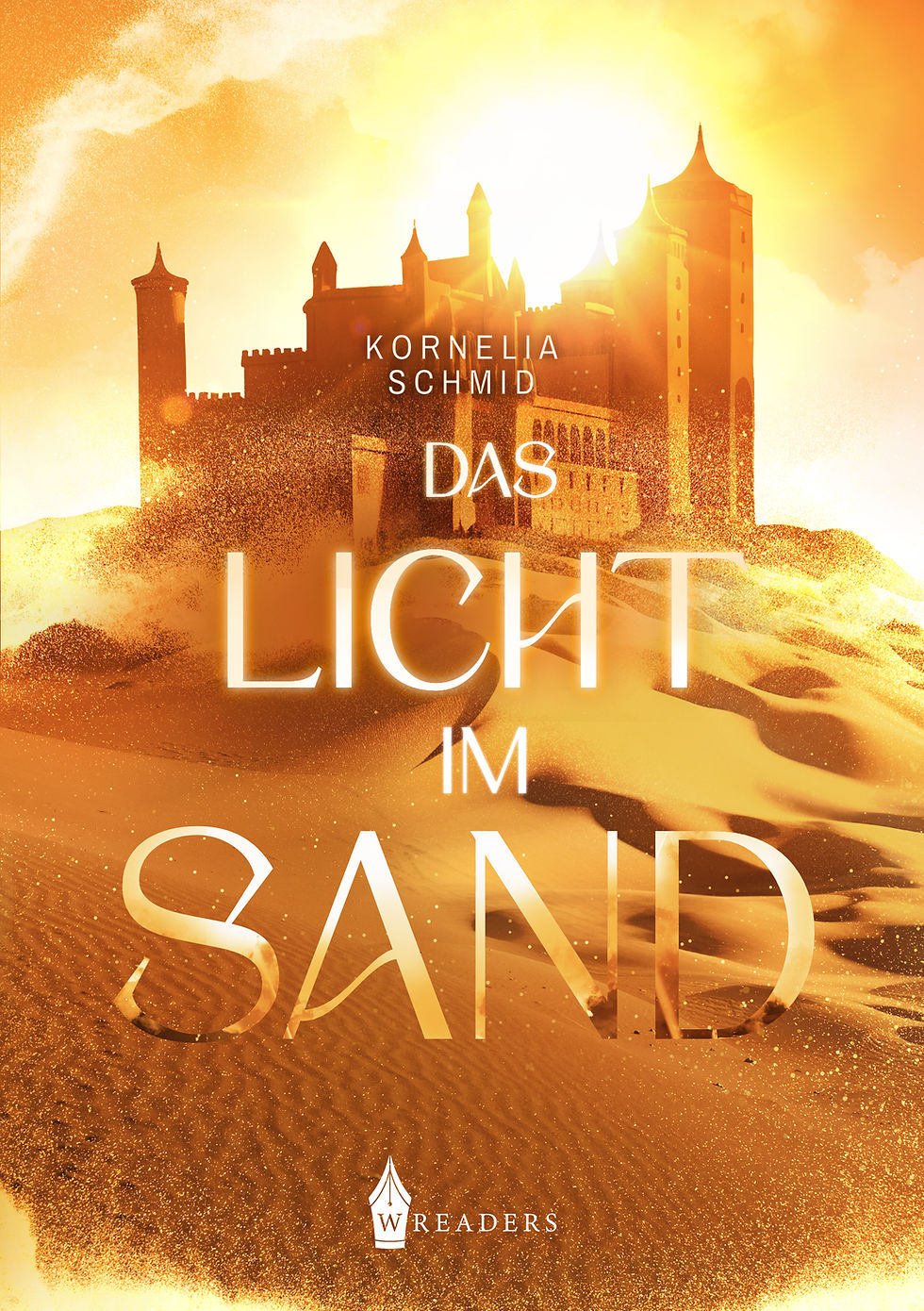


Kommentare